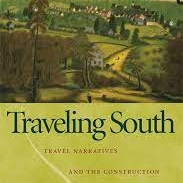Es kann sich hier aufgrund der Fülle an Material um keine erschöpfende Liste aller vorhandener Reiseliteratur handeln. Wo sollte da man anfangen? Wo enden? Es ist vielmehr eine subjektive Liste all jener Werke, die bei der Entstehung dieser Webseite in irgendeiner Weise Pate standen. Eine wichtige Rolle spielen natürlich die klassischen Reiseberichte, Reiseerinnerungen und Reisetagebücher, mit ihrem je eigenen Mischungsverhältnis aus Beschreibungen von Reisen an sich und Beschreibungen von bereisten Orten. Diese Werke weisen oftmals einen hohen Grad an realistischer (manchmal naturalistischer) Darstellung auf, die mit einer stark stilisierten, literarischen Sprache kontrastiert. Zwischen der exakten Beschreibung und der phantasievollen Erfindung erstreckt sich jedoch ein unermessliches Hochgebirgssystem, eine endlose nebelverhangene Grauzone, in der buchstäblich alles möglich ist. Und dennoch: nur ein schmaler Grat markiert den Übertritt von der ernsten Dokumentation, dem Tagebuch, dem reinen Tatsachenbericht, zur fiktionalen Literatur. Die Reiseschriftstellerei ist seit jeher ein Tummelplatz für Hochstapler und begnadete Lügner: Herzog Ernst, Karl May, Grey Owl, Bruce Chatwin.
Der uns hinterlassene Korpus von Reiseliteratur aus ungefähr drei Jahrtausenden ist bereits unmöglich zu erfassen. Richtiggehend absurd aber wird das Vorhaben einer vollständigen Bibliographie spätestens dann, wenn man der Meinung anhängt, dass das Leben selbst eine Reise ist, wie es in einer berühmten Zeile von Matsuo Bashō heißt; und noch einmal absurder, wenn es sich gar nur um eine “innere Reise” handelt und der Abenteurer keinen Fuß vor die Tür setzt. Dann wird zum Beispiel auch der Bericht eines Henry David Thoreau über sein zweijähriges Experiment, das sich im Radius von wenigen Kilometern rund um den Walden Pond in Massachussetts abspielte, zu einer Art von Reiseliteratur.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die seltsame Teil-Kongruenz von “travel writing” und “place writing”. Manche Autoren wie zum Beispiel Thoreau in Walden beschreiben weniger das Reisen an bestimmte Orte, als vielmehr die Orte selbst. Nicht selten – wenn auch nicht immer – sind die Zielorte interessanter als die oft mühevolle und wenig glamouröse Anreise. “Place writing” überschreitet manchmal auch die Grenze zur wissenschaftlichen Literatur, zum Beispiel zur Geographie, Geologie, Biologie, etc.
Schließlich kommen noch Werke hinzu, die strenggenommen gar nicht unter “Reiseliteratur” fallen, z.B. utopische Literatur, wissenschaftliche Literatur aus den Bereichen Geschichte, Geografie, Philosophie u.a.
Und was ist mit den Reisen Platons oder Francis Bacons nach Atlantis? James Harrington nach Oceania? Aldous Huxley auf sein Island? Was ist mit Herman Melvilles Moby Dick? Was ist mit Jules Verne? Was ist mit Karl May? Was ist mit Grey Owl über die “Men of the Last Frontier”?
Oft ist eine genaue Einordnung schwierig. Richard Francis Burtons Pilgrimage to El-Medinah and Meccah (1855) zum Beispiel ist keine reine Pilgerreise, sondern auch eine historische Entdeckungsreise. Peter Levis The Light Garden of the Angel King (1984) ist kein reines Reisetagebuch, sondern auch eine archäologische Exkursion. Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719) hielt das Publikum der Erstausgabe für einen Tatsachenbericht und nicht für eine erfundene Geschichte. Joseph Conrad bezog die Inspiration zu seinem Roman Heart of Darkness (1899) aus seinen eigenen Reisen auf dem Kongo acht Jahre zuvor. Was ist Henri Charrières autobiografischer Roman Papillon (1969) anderes als eine unglaubliche Reisegeschichte? Robert M. Pirsigs Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values (1974) ist nicht nur ein Motorrad-Roadtrip durch den Norden der Vereinigten Staaten, sondern auch das Dokument einer autobiografischen philosophisch-spirituellen Suche.
Man könnte auch sagen: In vielen Arten von Literatur steckt ein Element von Reisen, und
Nicht zuletzt werden viele Reisen erst durch die Lektüre von Reiseberichten angestoßen oder ermutigt. So war Christopher Columbus zum Beispiel von den Berichten über die Reisen Marco Polos und John Mandevilles beeinflusst.
Im Laufe der Zeit wandelten sich die Begründungen, warum eine Reise überhaupt angetreten wurde. Handelsreisen und militärische Expeditionen stehen am Anfang des dokumentierten Reisegeschehens. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Im toten Winkel der Weltgeschichte ist der homo sapiens immer schon gewandert. Die Besiedelung der Erde selbst war ein Akt des Reisens. Die Erfahrung blieb der Gattung so tief in den Knochen stecken, dass sie lange am Nomadentum festhielt und erst die überreichen Erträge ab der neolithischen Revolution die Sesshaftwerdung attraktiv erscheinen ließen. Viele Völker blieben zumindest teilweise nomadisch: nordamerikanische und australische Ureinwohner, Beduinen in Libyen.
Wo die Sesshaftwerdung vollzogen wurde, verkünstelten und verschärften sich unweigerlich die Begründungen für Reisen. Manchmal, wie im Fall der griechischen Feldzüge der Ilias, erhielten offensichtliche Militärexpeditionen eine religiöse Legitimation durch Götterurteil. Prozessionen zu heiligen Stätten waren schließlich ein allseits bekanntes Motiv, das sich bequem mit Kriegen verknüpfen ließ. Entdeckungsreisen – ursprünglich aus den Handels- und Eroberungsfahrten hervorgegangen – verselbständigten sich zu eigenständigen Sujets, und gerieten manchmal zu reinen Abenteuerreisen. Alle diese Reisen konnten immer schon in Odysseen und Irrfahrten enden. Homerische Zyklopen, Sirenen, Greifen und all die anderen Monster, die in der gefährlichen Fremde lauerten, lieferten die Grundlage für die mittelalterliche Phantastik mit ihren wunderlichen Tierarten und auf dem Kopf stehenden Antipoden. Schließlich treten religiöse Motive der monotheistischen Religionen hinzu. Es entstehen Pilgerfahrten. Aus Militärexpeditionen werden Kreuzzüge. An der Schnittstelle von Kreuzzug, Pilgerfahrt und Abenteuerreise entsteht die mittelalterliche Sonderform der Gralssuche, die wiederum einen enormen Einfluss auf den modernen Abenteuerroman hat und nebenbei auf die neuzeitlichen Entdeckungsfahrten rückwirkt. Das Zeitalter der Entdeckungen wiederum mündet in der Conquista, in den Missionen und in der weißen Besiedelung des gesamten amerikanischen Kontinents. Zeitgleich müssen Millionen von afrikanischen Sklaven ihre Verschleppung – erzwungene Reisen ohne Wiederkehr – erdulden. Unter reichen Europäern wie Duke Hamilton oder Johann Wolfgang von Goethe gilt eine “Grand Tour” durch Europa fast schon als obligatorisch. Für die einfachen (männlichen) Menschen in Europa liefen nur die Handwerker-Walz oder die Seefahrt die wenigen Ausreden, das elterliche Dorf verlassen zu dürfen. Vagabundieren scheint für einige Menschen so attraktiv zu sein, dass es bis ins 20. Jahrhundert hinein unter Strafe steht. Bis zur Backpacker-Manie, zum Hippie-Trail und erst recht bis zum “Easyjet-Set” ist es noch ein weiter Weg, der mühsam von philosophierenden Transzendentalisten und dichtenden Beatniks bereitet werden muss.
Die Einordnung der verschiedenen Werke in Kategorien ist schwierig, da sie sich vielfach überschneiden. Auch ein multidimensionales Koordinatensystem wird der Aufgabe nicht ganz gerecht.
The category “nature writing” includes also “place writing” and …. These kinds of works belong to the overarching category of “travel works” by and large, since getting into nature or to a certain place demands some form of travel. Yet they may not fit the categories of a “travelogue”, of “travel fiction”, or of a “non-fiction” book.
Please read this article on “The History of Travelling” for further information and orientation.
Reiseliteratur hat selbst den Anstoß gegeben zu:
- weiteren Reisen, so war Christopher Columbus zum Beispiel von den Berichten über die Reisen Marco Polos und John Mandevilles beeinflusst.
- fiktiven Reisen
Ein gutes Beispiel ist auch utopische Belletristik, die immer schon von Reise-Motiven durchzogen war – denken wir an die Reisen zu fremden Planeten und Sternen in der Science-Fiction-Literatur. Und was ist mit den Reisen Platons oder Francis Bacons ins sagenumwobene Atlantis? Was ist mit James Harrington Reise nach Oceania? Was ist mit der Zeitreise Edward Bellamys ins Jahr 2000? Was ist mit Aldous Huxleys Reise auf sein Pazifik-Eiland? Was ist mit Herman Melvilles Moby Dick? Was ist mit Jules Verne? Was ist mit Karl May? Was ist mit Grey Owl über die “Men of the Last Frontier”?
Walkabout (Aborigines), Angya (Zen-Buddhismus), Pilgerreise (Christentum), Hadsch (Islam), Gralssuche (Europa), Walz (Handwerker), Spaziergang, Hiking (Modernes Wandern).
Nothing found.
Nothing found.