
Der Palmenstrand von Vai
Über die Geschichte eines heiligen Symbols
Nach etwa 7 km erreichten wir die Grenze zu Vorarlberg. Im kleinen Café (noch auf deutscher Seite) gönnten wir uns einen Kaffee und kamen mit einem Motorradfahrer ins Gespräch.
Nach etwa 7 km erreichten wir die Grenze zu Vorarlberg. Im kleinen Café (noch auf deutscher Seite) gönnten wir uns einen Kaffee und kamen mit einem Motorradfahrer ins Gespräch.
Wir fuhren auf guten Asphaltstraßen durch dieses karge, fast wüstenähnliche Land hier im äußersten Nordosten der Insel, und wunderten uns schon sehr über Gewächshäuser und Plantagen, die ihren Verlauf säumten. Offenbar gab es hier doch mehr Wasser, als der erste Eindruck vermuten ließ. Unterirdische Aquifere, Rückhaltebecken, ein paar Quellen, ein paar klägliche Flussläufe aus den flachen Bergen. Vai lag an einem solchen Fleckchen rotgelber Erde, dessen spärliche Landwirtschaft die Anwesenheit eines auf den ersten Blick unsichtbaren Wasserlaufs verriet. An einer Kreuzung der Hauptstraße stand ein einfacher Holzverschlag in der staubigen, geradezu texanischen Einöde. Einheimische Bauern verkauften dort Obst und Gemüse.
Von dort bog eine Zufahrtsstraße nach Osten ab und schlängelte sich zwischen den flachen Karsthügeln hindurch, die das Land zum Meer hin abschirmten. Rechterhand das übliche Bild mit hingetupften Thymiansträuchern und kargem Macchie-Bewuchs. Linkerhand jedoch die kleine Sensation: ein langes, schmales Flussbett mit sehr sandigem Untergrund, das in der Feuchtperiode ausreichend Wasser führte. Im Bereich dieses Flussbetts gedieh ein ca. 20 Hektar großer Palmengarten. Der Bewuchs verlief von der Straßenkreuzung über 800 Meter weit bis zum Strand hinunter.
Map & Track
km 01 — 63 (of 250)
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.
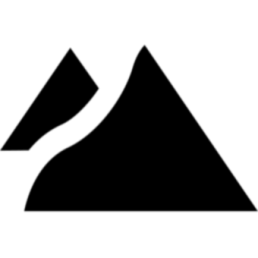
TERRAIN Mountains
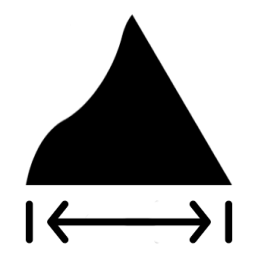
DISTANCE 62.35 km
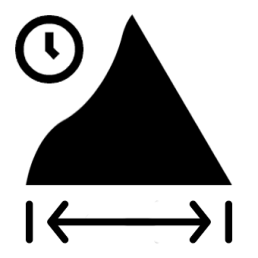
DURATION 1 day (ca. 7 hrs)
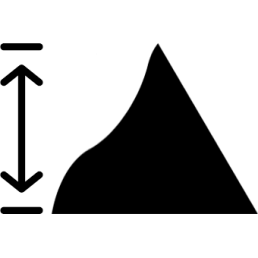
ALTITUDE DIFF. 963 m
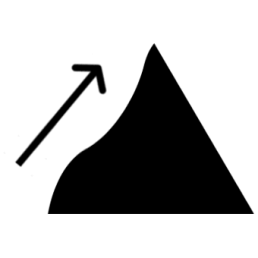
CLIMB 1,609 hm
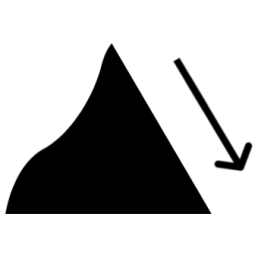
DESCENT 912 hm
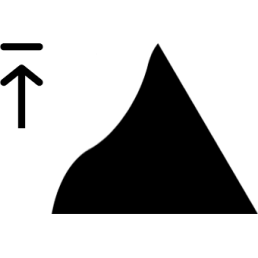
HIGHEST 1,491 m
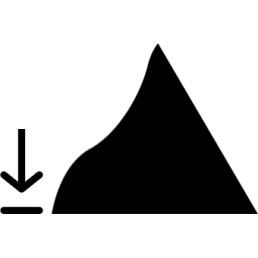
LOWEST 528 m
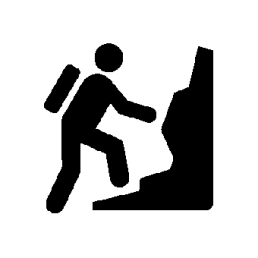
DIFFICULTY ●●●○○
FITNESS ●●●●○
SCENERY ●●●●●
SIGHTS ●●●○○
Um die Entstehung des Palmenhains von Vai rankten sich verschiedene Legenden. Eine davon erzählte, dass einst ägyptische Soldaten in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die Kerne ihrer mitgebrachten Datteln waren auf den fruchtbaren Boden des Flusstals gefallen und so wurde der Palmenhain geboren. Eine andere Legende besagte, dass es hingegen sarazenische Piraten im Mittelalter gewesen waren, die bei ihren Raubzügen entlang der kretischen Küste die Früchte fallen gelassen hatten.
Auf jeden Fall erklärten die Kreter sich den Ursprung „ihrer“ Palme aus dem Nahen Osten. Unser Begriff “Sarazenen“ ist ja heute noch ein lateinisches Lehnwort aus dem Arabischen und bedeutete wörtlich „Menschen des Ostens”. Es hatte im europäischen Mittelalter als Sammelbezeichnung für alles “Fremde“ gedient, was aus dem Orient kam: deren Herrscher, deren Piraten, deren Sitten, deren Datteln.
Zahlreiche archäologische Funde, darunter minoische Vasen mit Palmenmotiven, belegen aber, dass die „Kretische Dattelpalme“ hier mindestens schon in der Bronzezeit verbreitet war — und nicht nur hier, sondern auch auf vielen anderen Inseln der minoischen Einflusssphäre, zum Beispiel den Dodekanes-Inseln Kalymnos, Nisyros und Symi, aber auch an der Küste des heutigen Südwestanatoliens. Wie die Minoer die Palme nannten, ist — wie so vieles von ihnen — nicht überliefert bzw. nicht entziffert.

Der Ort selbst hat seinen modernen Namen von der Palme erhalten. „Vai“ ist ein lokaler Begriff für den Zweig der Palme, und „Vayies“ (oder „Vayiones“) bezeichnet die Palmen selbst. Ihr botanisch korrekter Name lautet „Theophrastus-Palme“. Der Schweizer Botaniker W. Greuter hatte sie 1967 als eigene Unterart der Gattung Dattelpalmen [simple_tooltip content=’This is the content for the tooltip bubble‘](Phoenix)[/simple_tooltip] identifiziert und nach ihrem Entdecker „Phoenix theophrasti“ getauft. Dieser Philosoph und Botaniker namens Theophrastos von Eresos nämlich, der erst bei Platon und dann bei Aristoteles studiert hatte, war der erste gewesen, der im 4. Jh. v. Chr. das Vorkommen dieser Palmen auf Kreta beschrieben hatte.
Palmen in der Antike
Die Geschichte eines heiligen Symbols
Dem gelehrten Theophrastos waren sicherlich die mythischen Geschichten, die Palme umgeben, geläufig. Die von Aristoteles gegründete Schule, die er leitete, tagte in einem Athener Tempel des Apollon, der nach dessen Begleiter und Beinamen “Lykeion” (Wolf) hieß. Ein weiteres Symbol des Apollon war… die Palme. Hesiod zufolge war er nämlich auf der Ägäisinsel Delos im Schatten einer solchen geboren worden.
Angeblich hatte Apollon später auch seiner Zwillingsschwester Artemis ein Exemplar seines heiligen Symbols geschenkt. Und so erklärte man sich, dass auch in Aulis, wo seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. der wichtigste Tempel der Göttin stand, ein Palmenhain wuchs. Als Theophrastos nur 60 Kilometer weiter südlich in Athen lebte und lehrte, existierte dieser Artemis-Tempel seit etwa 100 Jahren. (Er wurde insgesamt über 800 Jahre lang bis etwa 400 n. Chr. genutzt.)
Nicht nur die 400 Jahre alten mythischen Göttergeschichten des Hesiod, sondern auch die ebenso alten Heldensagen des Homer gehörten im klassischen Athen zum Allgemeingut. Theophrastos waren natürlich die Verwicklungen rund um den mykenischen König Agamemnon kurz vor Beginn des Trojanischen Kriegs ein Begriff. Als sich Homer zufolge die Schiffe der Griechen in Aulis versammelten, tötete der eitle Agamemnon aus purer Jagdlust eine von Artemis´ heiligen Hirschkühen, woraufhin die Göttin seiner abfahrtsbereiten Flotte eine völlige Flaute bescherte, woraufhin Agamemnon die Opferung seiner Tochter Iphigenie veranlasste, um Artemis milde zu stimmen, und so weiter.
▲ Palmenhain von Vai
▲ Palmenhain von Vai
Vielleicht kannte Theophrastos auch die Szene, in der Odysseus auf der letzten Station seiner Irrfahrt bei den Phäaken die Schönheit ihrer Königin Nausikaa mit der Schönheit einer hohen Palme verglich, die er zum ersten Mal auf der Apollon-Insel Delos gesehen hatte:
…Staunen überwältigt mich, wenn ich dich sehe.
Ein solches Staunen, wie ich es auf Delos am Altar des Apollo empfand,
als ich eine junge Palme in der ganzen Kraft ihres Wachstums sah.
Ich war dort mit vielen Gefährten gestrandet,
auf dem Weg, der mir zur Qual bestimmt war.
Und so wie ich diese Palme mit Ehrfurcht betrachtete,
wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte,
so blicke ich jetzt mit Staunen und Verwirrung auf dich…
— Homer: Odyssee, VI
Das archaische und klassische Griechenland hatte die symbolische Heiligkeit der Palme natürlich nicht erfunden. Das Symbol hatte sich bereits in früheren Zeiten von den ältesten Hochzivilisationen im fruchtbaren Halbmond und in Ägypten über die Levante ausgebreitet, und war spätestens in der Bronzezeit im gesamten Ostmittelmeerraum verbreitet. Im Brauchtum der Sumerer aus dem Zweistromland, einer der ersten und wichtigsten Hochzivilisationen, war die Palme essentieller Bestandteil eines symbolischen Neujahrsfestes, bei dem eine Hochzeit im Götterhimmel gefeiert wurde. Im nachfolgenden Reich der Assyrer, das kulturell stark von Sumer beeinflusst war, erschienen regelmäßig palmenblattförmige Ornamente auf Fresken zum Beispiel in der neuassyrischen Hauptstadt Ninive, auf denen herrschaftliche Szenen und Siegesfeiern abgebildet wurden. Durch seine vergleichsweise lange Lebensdauer bis an die Wende zum 6. Jh. v. Chr. und durch seinen Charakter als erstes „Großreich“ der menschlichen Zivilisationsgeschichte strahlte das Reich der Assyrer auf viele andere benachbarte Kulturen wie die Griechen ab.
Bezeichnenderweise verbanden die Griechen die Palme seit jeher mit deren angenommener Herkunft aus der Levante (aus dem Osten, aus dem Orient). Ihr Wort für die Pflanze (Φοῖνιξ Phoînix) war ein sogenanntes Ethnonym, das auf „Phoenizien“ verwies, also jenen Verbund von levantinischen Stadtstaaten wie Sidon und Tyros, von denen die Griechen nicht nur das Alphabet übernahmen, sondern mit der phoenizischen Prinzessin „Europa“ auch ihre bedeutendste Herkunftslegende.
Der synonyme Charakter des Siegessymbols der „Palme“ (Phoinix) und der „Menschen aus dem Osten“ (Phönizier) wurde bei den Griechen etwas später auch noch zu einem sarkastischen Wortspiel. In der Schlacht von Eurymedon im Jahr 465 v. Chr. hatte die „Delische Liga“ die mit den Persern verbündete 200-schiffige phönizische Flotte vernichtend geschlagen und damit die Expansion des Perserreichs gestoppt. Die „Delische Liga“ war das siegreiche Bündnis von mehreren hundert griechischen Stadtstaaten — zwar unter der Führung Athens (darum auch „Attischer Seebund“ genannt), aber mit Hauptsitz auf der Apollon-Insel Delos.




▲ Assyrisches Wandrelief aus Gips mit Darstellung einer luxuriösen Szene des Königs Aššur-bāni-apli und seiner Frau in einem Palmengarten. Der links in einem Baum hängende Kopf des Königs Teumman von Elam verrät den Zweck des Reliefs als Sieges-Inszenierung des assyrischen Königs. Nördlicher Palast von Ninive, ca. 645-635 v. Chr. British Museum of London.
Im Laufe der Jahrhunderte vollzog sich eine Verwandlung der Palme vom rein göttlichen Heiligkeitssymbol zu einem Sieges-Symbol derjenigen Menschen, die im Schutze der jeweiligen Gottheit standen. Und so kränzten fortan Palmzweige die Häupter der Sieger bei den Olympischen Spielen der Antike — als Symbole des Triumphes und der Freude, und natürlich des göttlichen Segens. Von Griechenland übertrug sich die Symbolik auf die römische Kultur. Römische Kaiser waren wie ihre assyrischen oder anderen Vorgänger naturgemäß Kandidaten für das lebenslange Tragen von Palm- oder Ölzweigen. Die Symbolik reichte so tief, dass man im antiken Rom das Wort „palma“ anstelle von „victoria“ (Sieg) verwenden konnte.
Das frühe Christentum, das genau am zentralen Schnittpunkt aller dieser Kulturen in der römischen Provinz Palästina entstand, präsentierte seinen Heiland genau als einen solchen triumphalen Sieger. Deshalb wurde Jesus von Nazareth bei seinem Einzug ins „Himmlische Jerusalem“ von der begeisterten Bevölkerung mit Palmwedeln begrüßt — so will es jedenfalls das Neue Testamtent. Zweige der Palme, „Vayia“, werden immer noch zum Flechten der Kreuze verwendet, die am Palmsonntag in der Kirche verteilt werden.
Die griechische „Phoînix“ Palme besaß außerdem noch einen Gleichklang mit dem mythischen Vogel „Phoenix“. Erfunden hatten das Symbol wohl die alten Ägypter im Rahmen ihres Sonnenkults (Ra bzw. Osiris), bei dem ein Reiher (Benu) am Abend starb und bei Sonnenaufgang in der Morgenröte wieder auferstand. Auch diese Tradition hatten die alten Griechen weitergeführt, wie ein Bericht des Herodot belegt. Seit der Spätantike war der Vogel zum Symbol der Unsterblichkeit geworden, da er angeblich die Fähigkeit hatte, sich im Feuer zu regenerieren, wenn Feinde ihn verwundet hatten.
Und so übernahmen auch die frühen Propagandisten des Christentum das geläufige Auferstehungssymbol kurzerhand für ihren „Christus“. Wie bei den Ägyptern der Sohn der Himmelssonne, so wurde bei ihnen der Sohn des abstrakten Himmlischen Vaters zum „Wiedergeborenen“, zum „neugeborenen Sohn“.
▲ Assyrisches Wandrelief aus Gips mit Darstellung einer luxuriösen Szene des Königs Aššur-bāni-apli und seiner Frau in einem Palmengarten. Der links in einem Baum hängende Kopf des Königs Teumman von Elam verrät den Zweck des Reliefs als Sieges-Inszenierung des assyrischen Königs. Nördlicher Palast von Ninive, ca. 645-635 v. Chr. British Museum of London.
Die Vermarktung eines Traums
Vom heiligen Symbol zum heiligen Kommerz
Ich sitze in einem der sonnengeschützten Cafés und betrachte die Massen von Touristen, die hier auch noch in der Nebensaison mit großen Reisebussen herangeschafft werden oder mit ihren Mietwagen vorfahren, zu Hunderten auf dem Parkplatz abgestellt. Warum zieht es sie so magisch an Palmenstrände? Wissen sie von all diesen Traditionen und Verweisen? Im Grunde feiern sie — auf eine verdrehte, postmoderne Weise — immer noch die als heilig empfundene Symbolik einer einfachen Pflanzenspezies.
Auch wenn sie beim Anblick einer Palme nicht in solche Verzückung geraten wie Odysseus bei der Phäaken-Königin Nausikaa — das Paradiesversprechen ist es doch, das sie anlockt. Ein Versprechen von übernatürlicher, himmlischer Schönheit: die Kombination aus Palmen und einem weißen Sandstrand. Wo es dazu noch Restaurants und Cafés gibt. Ein Ort, der Luxus mit Natur so verbindet, dass der Überfluss nicht allzu schnell fad oder schal wird. Spielt auch eine Rolle, dass man sich inmitten von Palmen unbewusst wie ein Sieger fühlen darf?



▲ Der touristische Strandkomplex von Vai mit dem großem Parkplatz, fein säuberlich aufgereihten Sonnenschirmen und dem typisch blendend guten Wetter Ostkretas.
Die künstliche Atmosphäre dieses touristischen Hotspots ist jedenfalls mit Händen zu greifen. Eine Anekdote aus den frühen 1970er Jahren steht synonym dafür, wie der moderne Mensch sich die Natur aneignet und einer erwünschten künstlichen Ästhetik unterordnet. Damals, als der Strand noch völlig unerschlossen war, wurde in Vai ein Werbespot für Bounty-Schokolade gedreht — die mit dem bekannten Marketing-Slogan „The Taste Of Paradise“. Um die ohnehin schon paradiesische Naturlandschaft noch künstlich aufzuwerten, ließen die Regisseure weißen Sand aufschütten. Der vorhandene Sand war ihnen nicht hell genug. Außerdem sorgten sie dafür, dass in den Dattelpalmen keine Datteln hingen, sondern Kokosnüsse. So wollte es der Auftraggeber.
Die Werbung machte das unbekannte irdische Paradies auf einen Schlag weltweit bekannt und Hunderte von Aussteigern strömten herbei — manchmal als Station ihrer „Grand Tour“ zu anderen kretischen Traumstränden wie Matala oder Preveli. Mit den Hippies stieg die Bekanntheit des wilden Campingplatzes von Vai. In den 1980er Jahren wurde der Strand im Sommer bereits von tausenden Rucksacktouristen überfallen. Das Paradies verkam schnell zu einer Müllkippe. Irgendwann schoben die Behörden einen Riegel davor. Der Palmenhain wurde eingezäunt und zu einem Naturschutzgebiet erklärt. Heute ist das Gelände nur tagsüber der Öffentlichkeit zugänglich.
Der Grund und Boden des Palmenstrandes — alles, vom Strand und den Palmen über die Imbisshäuschen bis zu den Toiletten — gehört im Übrigen dem nahegelegenen Kloster Toplou. Und auch da frage ich mich, ob die Touristen das wissen. Jede Portion Pommes und die 4 Euro Parkgebühr füllen die heiligen Kassen, wenn auch ein Teil davon sicher in den Naturschutz und die Pflege des Areals zurückfließt.




▲ [1] Nachbarstrand „Psili Ammos“ [2] Bucht von Vai
▲ [1] Nachbarstrand „Psili Ammos“ [2] Bucht von Vai
Das Heilige Kloster von Toplou als eines der wichtigsten Klöster auf Kreta ist auch größter Landbesitzer der ostkretischen Halbinsel. Es wurde im Zeitalter der Herrschaft Venedigs im 14. Jahrhundert im Stil einer Festung erbaut. Der Name „Toplou” wurde ihm später verliehen. Er ist türkischer Herkunft und bezieht sich auf das während der osmanischen Zeit erlange Recht des Klosters, eine Kanone zu besitzen.
In diesem Kloster befindet sich auch eine Steininschrift aus dem Jahr 132 v. Chr., die in den Ruinen des nahegelegenen Itanos (auch „Erimoupolis“ genannt) gefunden wurde. Dabei handelte es sich um einen Schiedsspruch des römischen Senats, der als „Diaitesia der Magneten“ bekannt wurde. Die römische Schlichtung betraf den Streit um die Insel Lefki (heute Koufonissi), die ein profitables Produktionszentrum des roten Purpur-Farbstoffs war. Rom schlug die Insel Itanos zu.
Der aufstrebende Rivale des älteren Itanos, den die Römer hier leer ausgehen ließen, obwohl die Insel Lefki ihm geografisch viel näher lag, hieß Hierapytna (das heutige Ierapetra). In Hierapytna wiederum wurden Münzen geprägt, die vorzugsweise Palmen zeigten — vielleicht auch eine Andeutung auf den Besitzanspruch der Stadt über die gesamte Südostküste, einschließlich des Palmenstrandes Vai, der sich eindeutig näher an Itanos befand.
Zwischen den beiden mächtigen Städten war es im 2. Jh. v. Chr. ständig zu territorialen Streitigkeiten und kriegerischen Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft über Ostkreta gekommen. Itanos war mit dem ptolemäischen Ägypten verbündet und hatte es um Hilfe gebeten. Die ägyptischen Truppen kamen, und sie landeten nur einen Kilometer südlich von Itanos, wo sie erstmals ihre Dattelkerne ausspuckten. Und so entstand die Legende um die Herkunft der Palmen auf Kreta und insbesondere in „Vai“, am „Palmzweig-Strand“. ■
In der nächsten Episode…
Unsere Arbeit Unterstützen
Supporte uns als Trail Angel
Wenn du wirklich dankbar bist für die Eindrücke und Inspirationen, die du durch travel4stories erhältst, würden wir uns sehr freuen, wenn du einer unserer „Trail Angels“ wirst und dabei hilfst, unsere kleine digitale Sparbüchse mit Reise-Karma zu füllen. Nur dank Unterstützern wie dir ist dieses Projekt überhaupt möglich. Selbst kleine Beträge tragen uns über weite Strecken.
*Click on the button above and follow three simple steps in the pop-up form of our trusted partner donorbox. Checkout is possible via credit card and PayPal. You can select a one-time or a recurring donation. For recurring donors, a donor account is created automatically. Account setup info will be mailed to you. You have full control over your donation and you can cancel anytime. Your personal data is always secure.
If you prefer donating in other ways, you can become our Patreon, or support us directly via PayPal.
Die Möglichkeiten, uns mit gutem Reise-Karma zu unterstützen, sind nahezu endlos. Mehr darüber erfährst du hier.
Wir möchten allen unseren Unterstützern von ganzem Herzen danken!
Mehr Entdecken
Stories & Images, Tours & Trails, Reise-Serien und vieles mehr...
Kommentare
Wir sind neugierig auf deine Meinung...




