Mit einem Gesamtanstieg von 1.609 Höhenmetern würde dies keine leichte erste Etappe werden, das war klar. Wie das langsame Crescendo eines Konzertsatzes folgen auf die relativ flache Passage durch den Bregenzerwald erst ein langsamer Anstieg nach Damüls und dann – quasi als finale, umgekehrte Kadenz – ein kurzer steiler Anstieg nach Faschina im Walsertal. Doch der Reihe nach. Ich saß am frühen Morgen in Oberstaufen (Allgäu) auf einer Bank der Aussichtsplattform „Hochgratblick“, im Rücken die beiden Engel der großen Skulptur, die ihre Trompeten in Richtung der Berge schwingen, und trank meinen Kaffee. Einen passenderen Beginn für das große Konzert der Alpenüberquerung konnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht würde die imaginäre Fanfare ja sogar für Rückenwind sorgen.
Triumphal begann ich die Tour mit dem einfachen kurzen Abstieg von Oberstaufen hinunter ins Tal der Weißach. Danach folgte ein letztes flaches Stück durchs Allgäu. Nach etwa 7 km erreichte ich die Grenze zu Österreich. Die kleine Grenzbäckerei im alten Zollhäuschen (noch auf deutscher Seite) hatte bereits geöffnet. Ich setzte mich an den einzigen Tisch vor dem Gebäude und nach kurzer Zeit gesellte sich ein älterer Motorradfahrer hinzu, mit dem ich ins Gespräch kam. Ein Bayer durch und durch, der seine Maschinen noch selber reparierte. Wir sprachen über den krassen Unterschied zwischen nord- und süddeutschen Landschaften, aber auch über das schwere Unwetter am Vortag, von dem nun gar nichts mehr zu sehen war.
Map & Track
km 01 — 63
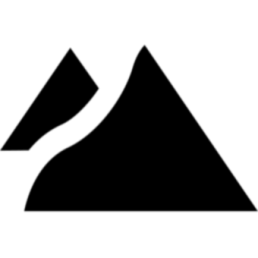
TERRAIN
Berge
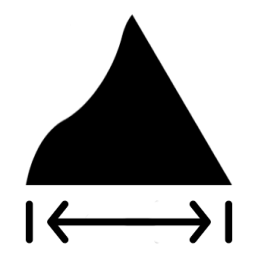
DISTANZ
62,35 km
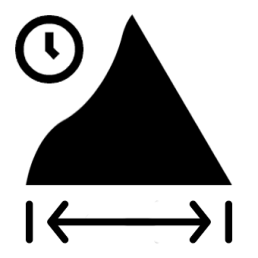
DAUER
1 Tag (ca. 7 Std.)
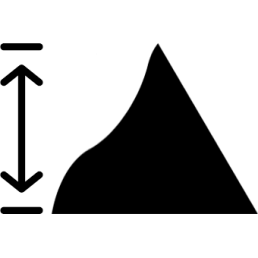
HÖHENUNTERSCHIED
963 m
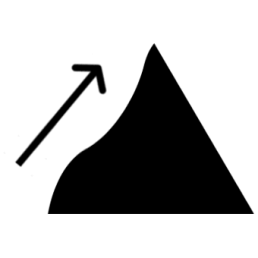
ANSTIEG
1.609 hm
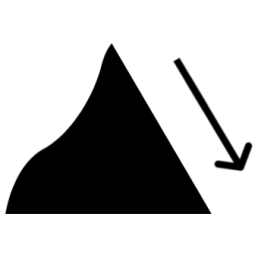
ABSTIEG
912 hm
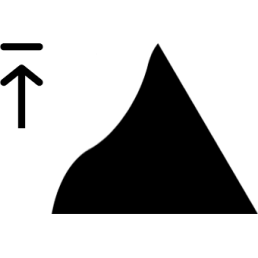
HÖCHSTER PUNKT
1.491 m
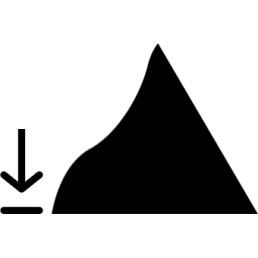
NIEDRIGSTER PUNKT
528 m
FITNESS
●●●●○
LANDSCHAFT
●●●●○
NATUR
●●●●○
KULTUR
●●●○○
An der Grenze zu Österreich
km 7 der Etappe | km 7 der Tour
Die eigentliche Grenze zwischen dem Allgäu und Vorarlberg liegt hinter einer Kurve mit kurzem steilem Anstieg. Es folgt eine sanfte Hügellandschaft in einem breiten Tal und ich rauschte in der Morgensonne auf der wenig befahrenen und perfekt asphaltierten Bundesstraße 205 an Riefensberg, Krumbach und Hittisau vorbei bis nach Lingenau.
Auf der 90 Meter hohen Lingenauer Brücke kam erstmals richtiges Bergfeeling auf, als ich eine große Gruppe Wildwasser-Kanuten tief unten im Tal der Weißach beobachten konnte – so gut es durch die vollkommen mit Maschendraht abgesperrte Brücke eben ging. Hier machte ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Bregenzer Ach, die mich nun auf einer Strecke von knapp 30 Kilometern durch den Bregenzerwald begleiten würde.
Der Bregenzerwald ist heute vor allem durch seine „Käsestraße“ bekannt – einem Zusammenschluss von Produktions- und Restaurations-Betrieben, die sich einer traditionsbewussten Herstellung und konzertierten Vermarktung dieses wichtigsten Exportprodukts ihrer Region verschrieben haben. Der Tourismus-Initiative ist es gelungen, den Bregenzerwälder Bergkäse weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen. Der Direktverkauf findet ganz modern über die etwas sonderbaren “Käse-Automaten” statt, die aber nicht nur Käse enthalten, sondern auch lokal produzierte Fleischwaren, Milch und manchmal Marmeladen und Süßigkeiten. Einige Höfe bieten sogar die Möglichkeit an, sich den Käse per Paketdienst liefern zu lassen.
Aber wie kam es eigentlich historisch gesehen zu dieser starken Fixierung der ganzen Alpenregion auf Milchprodukte, vor allem Produkte aus der Milch des Alpenrindes? Kaum eine andere regionale Wirtschaft in Europa ist ja so sehr auf eine Tierart zugeschnitten, von ihr abhängig und von ihr beeinflusst wie der Alpenraum. Die Kühe sind allgegenwärtig, ebenso wie die angeschlossene Infrastruktur aus Ställen, Tränken, Weiden, und natürlich der typische Geruch – eine Mischung aus Gras, Heu und Gülle. Die Kühe spenden Identität, ein Heimatgefühl. Jede Region hatte traditionell ihre „eigene“ Kuhrasse. In der Innerschweiz, in Graubünden und in Vorarlberg graste seit dem Mittelalter vor allem das Braunvieh. Im Berner Oberland hingegen traf man vor allem das blassrote Simmentaler Fleckvieh an. Im Wallis standen kleine braungefleckte Hochgebirgskühe auf der Weide. In Fribourg und in der Nordwestschweiz hielt man Rotbunte und Schwarzbunte. In der Schweizer Brünig-Napf-Reuss-Linie kommt diese Zergliederung exemplarisch zum Ausdruck. An dieser Kulturgrenze scheiden sich nicht nur Isoglossen, Volksbräuche und sogar Skatblätter, sondern auch die traditionellen Verbreitungsgebiete von Fleckvieh und Braunvieh. Noch heute unterhalten sich die Bauern darüber, wenn in einer anderen Herde Kühe mit „falscher“ Fleckung stehen. Und gar norddeutsche „Holstein-Rinder“ mit dem hohen Milchertrag bei geringem Fettgehalt gelten überall in den Alpen als „fremd“. Man spricht ihnen die Geländegeängigkeit und auch die Zähigkeit ab. Auch die zierlichen rehbraunen Jersey-Kühe mit geringer Milchleistung bei hohem Fett- und Eiweißgehalt werden skeptisch beäugt. Eigentlich, so sieht es der traditionsbewusste Alpenbewohner insgeheim, gehört nur das traditionelle Vieh seiner Region auf die Weide.
Im historischen Kontext stellt sich die Angelegenheit ganz anders dar: alle Kühe, seien sie nun graubraun oder lila, gefleckt oder nicht, stammen von einer einzigen Urzüchtung derselben Tiergattung ab, nämlich des eurasischen Hausrindes (Bos taurus), und dessen Ursprung liegt weit von den Alpen entfernt. Es ist das Ergebnis der Domestikation des eurasischen Auerochsen (Bos primigenius) in der Region des fruchtbaren Halbmonds in Vorderasien. Auf dem Gebiet der heutigen Levante, in Syrien, in der Südtürkei und im Zweistromland des heutigen Irak begannen ab etwa 9500 v. Chr. die ersten nomadischen Jäger- und Sammlerkulturen mit der Züchtung von Tieren. Hausrinder, Hausschafe und Hausziegen wurden allmählich aus den genetischen Korsetten ihrer wilden Vorfahren herausgelöst und als lebender Fleisch- und Milchvorrat mit der Gemeinschaft mitgeführt. In der „neolithischen Revolution“ mit den ersten sesshaften Ackerbaukulturen vollzog sich die Domestizierung der Tiere sowie die Systematisierung und Intensivierung der Nutztierhaltung noch radikaler, nicht zuletzt wegen der Einführung des Jochs und der Nutzung von Ochsen zum Pflügen der Felder. Wanderungswellen sorgten für die Ausbreitung der neuen Tierrassen. Ein paar Jahrtausende später hatten die ersten Hirten mit ihren Herden und die ersten sesshaften Bauerngemeinschaften mit Viehhaltung den Bosporus überschritten. Weiter nördlich breitete sich die Ökumene über das Ufer des Schwarzen Meeres nach Westeuropa aus. Noch etwas später betraten wohl die ersten Kühe den steilen und felsigen Alpenboden.
Überall wo sie hinkamen, wurden die Hausrinder zum Gegenstand kultischer Verehrung. In der eurasischen Mythologie stand der Stier zum einen für Zeugungskraft und Fruchtbarkeit, zum anderen für die Kraft des Himmels, der unablässig von einem stoischen Stier im mit der Weltenachse verbundenen Joch gezogen wird. Im mesopotamischen Gilgamesch-Epos tötete der König von Uruk den gewaltigen „Himmelsstier“, woran seither das Sternbild „Stier“ erinnert. Der griechische Göttervater Zeus machte sich in Gestalt eines Stiers an die phönizische Prinzessin Europa heran und verschleppte sie auf die Insel Kreta. Ihr beider Sohn wurde König Minos von Kreta. Poseidon bestrafte ihn, indem er dafür sorgte, dass seine Gemahlin mit dem Himmelsstier fremd ging, woraus das Mensch-Stier-Mischwesen Minotaurus entsprang. König Minos ließ das Ungeheuer im Labyrinth des brillanten Baumeisters Daidalos einsperren und ihm zur Besänftigung Menschenopfer darbringen. Erst Theseus beendete den Opferritus und tötete das Monster. Auch der Held Herakles muss in seiner achten „Herkulesaufgabe“ einen Stier bändigen. In der iranischen Mythologie wird die Erde von einem Stier getragen. Kühe wurden im Alten Ägypten ebenso verehrt wie in Indien, woher das sprichwörtliche Tabu der „heiligen Kühe“ stammt. Islamische Eroberer trieben ihren Heeren Kühe voran, weil ihre hinduistischen Gegner dann keinen Angriff wagten. Nicht weniger sprichwörtlich wurde das „Goldene Kalb“, dass die ungehorsamen Israeliten aus ihrem Goldschmuck schmiedeten. Neuere Spuren von Rinderkulten in Mitteleuropa, speziell im Alpenraum, sind zum Beispiel die geschmückten Pfingstochsen und der traditionelle Almabtrieb im Herbst.
Der wilde Urahn dieser gefeierten Nutztierrasse – der seit mindestens 275.000 Jahren in Europa heimische Auerochse – existierte unterdessen neben den sesshaft gewordenen Kulturen des ehrgeizigen homo sapiens weiter. In den ausgedehnten und dichten Wäldern Europas konnte sich das Urviech verstecken und bis in jüngere Zeit halten.
Die Auerochsen seien etwas kleiner als Elefanten und so stark und wild, dass sie nicht gezähmt werden könnten. Die Germanen würden sie mittels Fallgruben jagen und ihre langen Hörner als Trinkgefäße und Trophäen verwenden.
—Julius Caesar in „De bello Gallico“
Der römische Feldherr Julius Cäsar traf ihn im sechsten Jahrzehnt v. Chr. im herkynischen Wald auf dem Gebiet der heutigen deutschen Mittelgebirge an und beschrieb ihn in „De bello Gallico“ als typische regionale Großtierart (neben Hirschen und Elchen). Die Ochsen seien „etwas kleiner als Elefanten“ und so stark und wild, dass sie nicht gezähmt werden könnten. Die Germanen würden sie mittels Fallgruben jagen und ihre langen Hörner als Trinkgefäße und Trophäen verwenden. Selbstredend ließ Caesar die wilden Bestien nach Rom schaffen und bei seinen bis zu fünf Tage dauernden Tierhetzen präsentieren. Die Germanen hatten den Auerochsen zugleich auch verehrt und ihm die zweite Rune in ihrem Alphabet Futhark gewidmet: Die U-förmige Rune „Uruz“ symbolisierte seine Hörner. In der Mythologie repräsentierte sie damit die ungezähmte Stärke des Ur-Ochsen, seine grenzenlose Schöpfungskraft, innere Stärke, Lebenskraft und Ausdauer. Wer einen solchen Kraftprotz erlegte, galt selbst als einer. Noch im frühmittelalterlichen Nibelungenlied heißt es, der Held Siegfried habe vier Ochsen („starker Ure viere“) zur Strecke gebracht.
In der frühmittelalterlichen Realität dürften Auerochsen hingegen schon äußerst selten gewesen sein. Fünf Jahrhunderte nach Cäsars Aufzeichnungen war das Weströmische Reich in den Wirren der Völkerwanderung untergegangen. Doch als die Krisen ausgestanden und neue Reiche geboren waren, nahm die Zahl der Menschen in Europa wieder zu. Ebenso wuchs die Zahl ihrer Herden und deren Bedarf an Weidefläche. Die Verdrängung wilder Tiere geschah systematisch. Da man dem Auerochsen keinen Zugang zum Genpool der eigenen Nutztiere gestatten und dadurch den Domestikations- und Zuchterfolg gefährden wollte, wurde er stark bejagt und starb vor allem durch die Waffen hoher Adliger, denn die Auerochsenjagd war ein Königsprivileg. Die merowingischen und karolingischen Rodungswellen im 7. bis 10. Jahrhundert und eine weitere fränkische Rodungswelle im 11. Jahrhundert vernichteten und zersiedelten die letzten dichten mitteleuropäischen Urwälder, zerstörten den natürlichen Lebensraum vieler wilder Tiere und verschoben ihre letzten Rückzugsgebiete weit in den Norden und nach Osten. Die letzte europäische Auerochsenkuh starb 1627 in einem Wald bei Warschau in Polen. Als man 1821 in der Nähe von Weimar ein Skelett aus dem Moor barg, erkannte Johann Wolfgang von Goethe dessen Bedeutung und beaufsichtigte höchstpersönlich die Restaurierung. (Das Auerochsen-Skelett befindet sich heute im Phyletischen Museum zu Jena.)
Ebenfalls im Mittelalter hatte derweil die extensive Alpenwirtschaft begonnen. Hirten und Bergbauern rodeten die bewaldeten Berglagen schrittweise von oben nach unten, um höher gelegene Alpflächen zu erschließen oder zu vergrössern. Die saisonale Bewirtschaftung schuf die charakteristische Landschaftsform der Bergweide. Eine frühe Form der ökonomischen Spezialisierung setzte ein, und so wie einst den Auerochsen verdrängte das Hausrind nun Schafe und Ziegen von den Weiden. Seit der Eröffnung der Gotthard-Route über den Alpenhauptkamm im 13. Jahrhundert war der Viehexport zunächst ins Alpenvorland immer wichtiger geworden. Bald gesellten sich Milch- und Käseprodukte hinzu. Wachsender Bevölkerungsdruck und die Suche nach immer neuen landwirtschaftlichen Anbauflächen führte zu Wanderungsbewegungen wie jener der Walser. Mit den Emigranten und über die Handelsrouten breiteten sich auch die Kenntnisse und Fertigkeiten um die Weidewirtschaft aus und vereinheitlichten und professionalisierten das Geschäft. Spätestens im 15. Jahrhundert hatte sich die Kuh als Haupt-Wirtschaftsfaktor durchgesetzt. Ihre Produkte Fleisch, Milch und Käse wurden in immer größerem Stil ins europäische Ausland exportiert. Bald begann die Vermarktung als „einheimisches Qualitätsprodukt“.

Im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert setzte mit Maschinisierung, Massenproduktion und globalem Handel ein extremer Wandel ein, dessen Verschärfung bis heute anhält und dem sich auch die traditionsbewussten Alpenwirtschaft nicht entziehen kann. Deutlicher als im Tourismusprojekt der „Käsestraße Bregenzerwald“ könnte das nicht werden. Aufgrund des rasanten Preisverfalls aller möglichen Käsesorten im Zuge des Wettbewerbs großer Handelsketten müssen immer mehr Sennereien im Alpenraum umdenken und neue Absatzstrategien entwickeln. Die exklusive Bindung an einzelne Großabnehmer, die alle Bedingungen inklusive des Preises diktieren können, erweist sich als riskant und potenziell ruinös. Auch der schrankenlose innereuropäische Wettbewerb mit den ungleich größeren Agrar-Multis wie Nestlé und Danone, für die Käse ein Milliardengeschäft ist, macht den Bauern das Leben schwer, und das obwohl der Markt riesisg ist: etwa ein Drittel des weltweit konsumierten Käses kommt aus der EU. Zudem reguliert die Europäische Union in Richtung Keimfreiheit und bevorzugt damit gewollt oder ungewollt den künstlichen Käse aus Milchpulver und benachteiligt den würzigen Alpenkäse aus frischer Milch.
Immer mehr Sennereien sind daher längst auf den Direktverkauf von Spezialitäten umgestiegen. Teilweise stellen sie nur noch den Bergkäse aus Rohmilch her, der über Jahrhunderte hinweg das Hauptnahrungsmittel der einheimischen Bevölkerung war. Damit kennen sie sich besser aus als jeder Großbetrieb. Ohne die Agrarbeihilfen von der EU und dem Land Österreich würde es aber dennoch nicht gehen. Käse-Automaten aufzustellen muss man sich bei Anschaffungskosten von mehreren tausend Euro erst einmal leisten können. Um die Qualität konstant hochzuhalten, gibt es vom Land vorgeschriebene strenge Anforderungen an die Käseherstellung. Artgerechte Haltung, Sauberkeit der Höfe und Anlagen usw. werden regelmäßig kontrolliert. Vor allem die Verwendung silagefreier Milch ist wichtig – also Milch von Kühen, die ohne Silofutter und ausschließlich mit Gras und Heu ernährt werden. Ob in der Realität nicht doch die eine oder andere Kraftfutter-Weizenkugel ihren Weg in Kuhbäuche findet, steht auf einem anderen Blatt.
Bislang ist die Geschichte der Bregenzerwälder Käsestraße jedenfalls ein Erfolgsmodell. Der Bregenzerwälder Bergkäse wurde in die „Arche des Geschmacks“ genannte Liste von gefährdeten traditionellen Lebensmittelprodukten der Slow-Food-Bewegung aufgenommen und außerdem in das Projekt der „Genussregion Österreich“ eingebunden. Er scheint sich recht gut an Abnehmer aus Hotellerie und Gastronomie zu verkaufen. Der Tourismus kann auch außerhalb der Skisaison mit neuen Argumenten angekurbelt oder zumindest stabilisiert werden. Schau-Sennereien bieten Kurse zum Mitmachen und Lernen, imposante Käsekeller können besichtigt werden, Museen zeigen die historische Entwicklung der Region, Volksfeste laden zum Feiern ein, und Alpen bieten vorbeikommenden Wanderern einen Direktverkauf ihrer Produkte an.
Ich decke mich an einem der Käseautomaten mit Proviant ein und setze meine Tour durch den Bregenzerwald fort. Auf sehr guten Radwegen geht es zwischen steilen, grün bewachsenen Felswänden hindurch, mit grandiosen Aussichten auf entfernte Höhenzüge. Auch im Wald sind die Radwege teilweise asphaltiert. Immer begleitet einen das Rauschen der Bregenzerach in der Nähe. Das Wegenetz ist für Tourenfahrer geeignet, aber man begegnet auch recht vielen Mountainbikern, die Abstecher in die steileren Hänge machen. An einer Stelle kreuzt man das verbliebene Stück der historischen Bregenzerwaldbahn, einer Museums-Schmalspurbahn, die einst die ganze Strecke von Bregenz nach Bezau durch das Tal der Bregenzer Ach befuhr, und dabei ca. 400 Meter Höhenunterschied überwand. Wie die Schmalspurbahn seit 1902 fahre auch ich an den Ortschaften Egg, Andelsbuch, Schwarzenberg und Reuthe vorbei.
In Au, auf mittlerweile 800 Metern üNN, endet die Passage durch den Bregenzerwald. Die Gemeinde Bezau ist eine Nachbargemeinde von Mittelberg, das bereits im Kleinwalsertal liegt. Unser Ziel ist jedoch das Große Walsertal, und dafür müssen wir in Au in das Seitental des Argenbachs einbiegen. Hier erfolgt nun der erste ernstzunehmende Anstieg der Tour. Auf einem Stück von nur 7 km geht es von ca. 850 Metern nach Damüls auf 1350 Meter hinauf – also durchschnittlich über 7% Steigung. Von diesem Sockel aus klettere ich auf einem 1,5 km kurzen Stück weitere 150 Meter nach Faschina auf 1490 Metern üNN, dem Ziel meiner ersten Etappe. Dieses letzte Stück ist noch einmal enorm kräftezehrend mit einer durchschnittlichen Steigung von 10%, die teilweise durch einen längeren Galerietunnel verläuft.
Da sich die anstrengenden Aufstiege allesamt am Ende der Etappe befinden, können Untrainierte und alle, die mit ihren Kräften haushalten wollen, eine Abkürzung nehmen: Auf dem Platz vor dem Tourismus-Büro von Au (47.321917, 9.980362) fährt regelmäßig ein Bus nach Damüls ab, der auch Fahrräder mitnimmt (Aufhängung am Heck). Die günstigen Fahrkarten kann man beim Busfahrer kaufen. ■
Unsere Arbeit Unterstützen
Supporte uns als Trail Angel
Wenn du wirklich dankbar bist für die Eindrücke und Inspirationen, die du durch travel4stories erhältst, würden wir uns sehr freuen, wenn du einer unserer „Trail Angels“ wirst und dabei hilfst, unsere kleine digitale Sparbüchse mit Reise-Karma zu füllen. Nur dank Unterstützern wie dir ist dieses Projekt überhaupt möglich. Selbst kleine Beträge tragen uns über weite Strecken.
*Click on the button above and follow three simple steps in the pop-up form of our trusted partner donorbox. Checkout is possible via credit card and PayPal. You can select a one-time or a recurring donation. For recurring donors, a donor account is created automatically. Account setup info will be mailed to you. You have full control over your donation and you can cancel anytime. Your personal data is always secure.
If you prefer donating in other ways, you can become our Patreon, or support us directly via PayPal.
Die Möglichkeiten, uns mit gutem Reise-Karma zu unterstützen, sind nahezu endlos. Mehr darüber erfährst du hier.
Wir möchten allen unseren Unterstützern von ganzem Herzen danken!
Mehr Entdecken
Stories & Images, Tours & Trails, Reise-Serien und vieles mehr...
Alpenüberquerung Etappe 01 — Durch den Bregenzerwald
Alpenüberquerung, Etappe 01: Vom Allgäu auf der "Käsestraße" durch den Bregenzerwald. Vom Eurasischen Auerochsen zur alpinen Weidewirtschaft.
Alpenüberquerung
Alpine Crossing from Oberstaufen (Allgäu, Bavaria, Germany) to Chiavenna (Lombardia, Italy) via Bregenz Forest, Great Walser Valley, Liechtenstein,…
Kommentare
Wir sind neugierig auf deine Meinung...
























